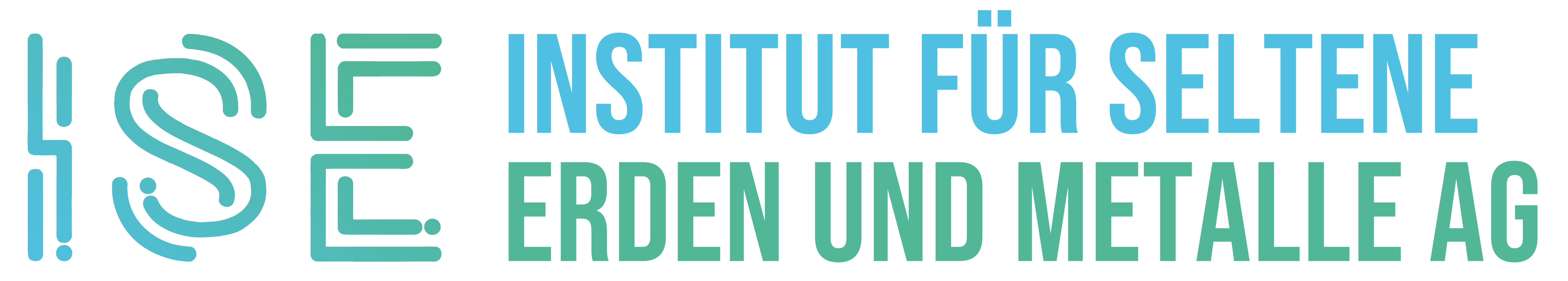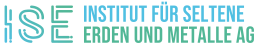V • Ordnungszahl 23
Vanadium
Vanadium ist silberweißes Übergangsmetall mit guter mechanischer Stabilität und Dehnbarkeit. Es hat einen sehr hohen Schmelzpunkt und ist korrosionsbeständig.
Seine Hauptanwendung ist die Verwendung als Zusatzstoff in Stahl und Titanlegierungen zur Verbesserung deren Festigkeit und Hitze- und Korrosionsbeständigkeit sowie als Katalysator für Chemikalien.
Die Bedeutung von Vanadium-Redox-Batterien für die Energiespeicherung nimmt zu und somit auch die Rolle von Vanadium als strategischer Rohstoff. IN der EU ist Vanadium auf der Liste für kritische Rohstoffe.
China, Südafrika und Russland sind die führenden Vanadiumförderländer
Der kanadisch-brasilianische Hersteller Largo ist Marktführer von Vanadiumprodukten insbesondere für hochreines Vanadiumpentoxid und Vanadium-Elektrolyte für Batterien.
In der EU und in den USA ist Vanadium als kritischer Rohstoff gelistet.
Vanadium wurde 1801 vom spanisch-mexikanischen Mineralogen Andrés Manuel del Río entdeckt und Panchromium bzw. Erythronium genannt. Allerdings wurde es im Anschluss für unreines Chrom gehalten.
Das Element wurde 1830 vom schwedischen Chemiker Nils Gabriel Sefström wiederentdeckt und nach Vanadis, der skandinavischen Göttin der Schönheit und Jugend, benannt. Der Name war aufgrund der schönen Farben der Vanadiumverbindungen in Lösung nahegelegt worden.
Der englische Chemiker Henry Enfield Roscoe isolierte das Metall 1867 erstmals durch Wasserstoffreduktion von Vanadiumdichlorid.
Die amerikanischen Chemiker John Wesley Marden und Malcolm N. Rich haben es 1925 in einer Reinheit von 99,7 Prozent durch Reduktion von Vanadiumpentoxid V₂O₅ mit metallischem Calcium gewonnen.
Anfang des 20. Jahrhunderts entdeckte man, dass Vanadium die Festigkeit von Stahl deutlich erhöht. Henry Ford verwendete es im Modell T (1908), was den Ruf von Vanadium als Legierungsmetall begründete.
Heute ist Vanadium wichtig für Redox-Flow-Batterien, Hochleistungsstähle und Speziallegierungen.
Die stabilsten künstlichen Isotope sind 48V mit einer Halbwertszeit von 16 Tagen und 49V mit einer Halbwertszeit von 330 Tagen. Diese finden als Tracer Verwendung. Alle anderen Isotope und Kernisomere sind sehr instabil und zerfallen in Minuten oder Sekunden.
90 Prozent des Vanadium-Bedarfs kommen aus der Stahlindustrie, wo Vanadium in verschiedenen Stählen und Legierungen für Werkzeuge, Achsen, Kurbelwellen, Zahnrädern und andere kritische Komponenten sowie in Düsentriebwerken und Flugzeugjets verwendet wird.
An Bedeutung gewinnt Vanadium für Vanadium-Redox-Flow-Batterien (VRFB). VRFB eignen sich besonders in Großspeicheranlagen für erneuerbare Energien, da sie eine hochsichere und umweltfreundliche mittel- und langfristige Energiespeicherung ermöglichen.Allerdings ist die begrenzte Verfügbarkeit von Vanadium als Rohstoff ein Nachteil der VRFB-Technologie.
Weitere Anwendungen sind Hochtechnologieanwendungen wie Supraleiter, Kernreaktoren, Katalysatoren, Keramik und Glas.
Obwohl es mit Carnotit, Vanadinit und Roscoelit vanadiumhaltige Erze gibt, entsteht es meist als Nebenprodukt von Eisen- (Magnetit) und Titanminen (Titanomagnetit).
China ist mit 60 Prozent Weltmarktanteil führend beim Vanadiumabbau. Das wichtigste Unternehmen ist Pangang in Sichuan, ein wichtiger Titanerzproduzent.
In Russland fällt Vanadium als Nebenprodukt bei der Stahl- und Eisenerzverarbeitung im Ural an. Der Konzern EVRAZ ist neben VSMPO-AVISMA ein globaler Schlüsselplayer.
Der Bushveld-Komplex in Südafrika ist eine weitere wichtige Quelle für den Vanadium-Abbau. Auch Brasilien und Australien fördern Vanadium.
Die globale Jahresproduktion beträgt um die 100.000 Tonnen.
Bestimmte Metalle wie Mangan, Molybdän, Niob (Columbium), Titan und Wolfram sind bis zu einem gewissen Grad als Legierungselemente in Stahl mit Vanadium austauschbar.
Physikalische Eigenschaften
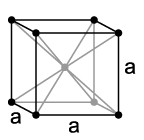
Kristallstruktur von Vanadium, a = 302,4 pm
Vanadium ist ein nichtmagnetisches, zähes, schmiedbares und deutlich stahlblaues Schwermetall mit einer Dichte von 6,11 g/cm3. Reines Vanadium ist relativ weich, wird aber durch Beimengungen anderer Elemente härter und besitzt dann eine hohe mechanische Festigkeit. In den meisten Eigenschaften ähnelt es seinem Nachbarn im Periodensystem, dem Titan. Der Schmelzpunkt von reinem Vanadium liegt bei 1910 °C, dieser wird jedoch durch Verunreinigungen wie Kohlenstoff deutlich erhöht. Bei einem Gehalt von 10 % Kohlenstoff liegt er bei etwa 2700 °C. Vanadium kristallisiert wie Chrom oder Niob in einer kubisch-raumzentrierten Kristallstrukturmit der Raumgruppe  und dem Gitterparameter a = 302,4 pm sowie zwei Formeleinheiten pro Elementarzelle.
und dem Gitterparameter a = 302,4 pm sowie zwei Formeleinheiten pro Elementarzelle.
Unterhalb einer Sprungtemperatur von 5,13 K wird Vanadium zum Supraleiter. Ebenso wie reines Vanadium sind auch Legierungen des Vanadiums mit Gallium, Niob und Zirconium supraleitend. Bei Temperaturen unter 5,13 K zeigt Vanadium, ebenso wie die Vanadiumgruppenmetalle Niob und Tantal, in kleinsten Klümpchen bis 200 Atomen eine bisher nicht erklärte, spontane elektrische Polarisation, wie sie sonst nur nichtmetallische Stoffe aufweisen.
Chemische Eigenschaften
Vanadium ist ein unedles Metall und in der Lage, mit vielen Nichtmetallen zu reagieren. An der Luft bleibt es wochenlang metallisch glänzend. Bei der Betrachtung über längere Zeiträume wird deutlich sichtbarer grüner Rost wahrgenommen. Soll Vanadium konserviert bleiben, so muss es unter Argon aufbewahrt werden. In der Hitze wird es von Sauerstoff angegriffen und zu Vanadium(V)-oxid oxidiert. Während Kohlenstoff und Stickstoff mit Vanadium erst bei Weißglut reagieren, findet die Reaktion mit Fluor und Chlor schon in der Kälte statt.
Gegenüber Säuren und Basen ist Vanadium bei Raumtemperatur meist stabil auf Grund einer dünnen, passivierenden Oxidschicht, angegriffen wird es nur von Flusssäure sowie stark oxidierend wirkenden Säuren wie heißer Salpetersäure, konzentrierter Schwefelsäure und Königswasser.
Eine Vorprobe liefert die Phosphorsalzperle, bei der Vanadium in der Reduktionsflamme charakteristisch grün erscheint. Die Oxidationsflamme ist schwach gelb und damit zu unspezifisch.
Ein qualitativer Nachweis für Vanadium beruht auf der Bildung von Peroxovanadiumionen. Dazu wird eine saure Lösung, die Vanadium in der Oxidationsstufe +5 enthält, mit wenig Wasserstoffperoxid versetzt. Es bildet sich das rötlich-braune [V(O2)]3+-kation. Dieses reagiert mit größeren Mengen Wasserstoffperoxid zur schwach gelben Peroxovanadiumsäure H3[VO2(O2)2].
Quantitativ kann Vanadium durch Titration bestimmt werden. Dazu wird eine vanadiumhaltige schwefelsaure Lösung mit Kaliumpermanganat zu fünfwertigem Vanadium oxidiert und anschließend mit einer Eisen(II)-sulfatlösung und Diphenylamin alsIndikator rücktitriert. Auch eine Reduktion von vorliegenden fünfwertigem Vanadium mit Eisen(II)-sulfat zum vierwertigen Oxidationszustand und anschließender potentiometrischer Titration mit Kaliumpermanganatlösung ist möglich.
In der modernen Analytik kann Vanadium mit mehreren Methoden nachgewiesen werden. Dies sind beispielsweise die Atomabsorptionsspektrometrie bei 318,5 nm und die Spektralphotometrie mit N-Benzoyl-N-phenylhydroxylamin als Farbreagenz bei 546 nm.
Vanadiumverbindungen besitzen verschiedene biologische Bedeutungen. Charakteristisch für Vanadium ist, dass es sowohl anionisch als Vanadat, als auch kationisch als VO2+, VO2+ oder V3+ vorkommt. Vanadate besitzen große Ähnlichkeit zuPhosphaten und haben dementsprechend ähnliche Wirkungen. Da Vanadat stärker an geeignete Enzyme bindet als Phosphat, ist es in der Lage, Enzyme der Phosphorylierung zu blockieren und so zu steuern. Dies betrifft beispielsweise die Natrium-Kalium-ATPase, die den Transport von Natrium und Kalium in Zellen steuert. Diese Blockierung kann mit Desferrioxamin B, das einen stabilen Komplex mit Vanadat bildet, schnell wieder aufgehoben werden. Weiterhin beeinflusst Vanadium dieGlucoseaufnahme. Es ist in der Lage, in der Leber die Glykolyse zu stimulieren und den Konkurrenzprozess der Gluconeogenese zu hemmen. Dadurch kommt es zu einer Senkung des Glucose-Spiegels im Blut. Daher wird untersucht, ob Vanadiumverbindungen für die Behandlung von Diabetes mellitus Typ 2 geeignet sind. Es sind jedoch noch keine eindeutigen Ergebnisse gefunden worden. Daneben stimuliert Vanadium auch die Oxidation von Phospholipiden und unterdrückt die Synthese von Cholesterin durch Hemmung der Squalensynthase, einem mikrosomalen Enzymsystem der Leber. Folgerichtig verursacht ein Mangel erhöhte Konzentrationen von Cholesterin und Triglyceriden im Blutplasma.
In Pflanzen spielt Vanadium eine Rolle in der Photosynthese. Es ist in der Lage, die Reaktion zur Bildung von 5-Aminolävulinsäure ohne Enzym zu katalysieren. Diese ist eine wichtige Vorstufe zur Bildung von Chlorophyll.
In einigen Organismen kommen vanadiumhaltige Enzyme vor, so besitzen einige Bakterienarten zur Stickstofffixierung vanadiumhaltige Nitrogenasen. Dies sind beispielsweise Arten der Gattung Azotobacter sowie das Cyanobakterium Anabaenavariabilis. Diese Nitrogenasen sind jedoch nicht so leistungsfähig wie die häufigeren Molybdän-Nitrogenasen und werden daher nur bei Molybdänmangel aktiviert. Weitere vanadiumhaltige Enzyme finden sich in Braunalgen und Flechten. Diese besitzen vanadiumhaltige Haloperoxidasen, mit denen sie Chlor-, Brom- oder Iod-organische Verbindungen aufbauen.
Die Funktion des in großen Mengen in Seescheiden als Metalloproteine Vanabine vorhandenen Vanadiums ist noch nicht bekannt. Ursprünglich wurde vermutet, dass das Vanadium ähnlich dem Hämoglobin als Sauerstofftransporter dient; dies hat sich jedoch als falsch herausgestellt.
Gefährdungen
Wie andere Metallstäube ist auch Vanadiumstaub entzündlich. Vanadium und seine anorganischen Verbindungen haben sich im Tierversuch als karzinogen erwiesen. Sie werden daher in die Kanzerogenitäts-Kategorie 2 eingeordnet. Wird Vanadiumstaub etwa von Arbeitern in der Metallverhüttung über längere Zeit eingeatmet, kann es zum sogenannten Vanadismus kommen. Diese anerkannte Berufskrankheit kann sich in Schleimhautreizung, grünschwarzer Verfärbung der Zunge, sowie chronischen Bronchial-, Lungen- und Darmerkrankungen äußern.
In Verbindungen kann Vanadium in verschiedenen Oxidationsstufen vorliegen. Häufig sind die Stufen +5, +4, +3 und +2, seltener sind +1, 0, −1 und −3. Die wichtigsten und stabilsten Oxidationsstufen sind +5 und +4.
Wässrige Lösung
In wässriger Lösung lässt sich Vanadium leicht in verschiedene Oxidationsstufen überführen. Da die verschiedenen Vanadiumionen charakteristische Farben besitzen, kommt es dabei zu Farbänderungen.
In saurer Lösung bildet fünfwertiges Vanadium farblose VO2+-Ionen, die bei der Reduktion zunächst zu blauen vierwertigen VO2+-Ionen werden. Die dreiwertige Stufe mit V3+-Ionen ist von grüner Farbe, die tiefste, in wässriger Lösung erreichbare Stufe, das zweiwertige V2+-Ion ist grauviolett.
Sauerstoffverbindungen
Die wichtigste und stabilste Vanadium-Sauerstoff-Verbindung ist Vanadium(V)-oxid V2O5. Diese orangefarbene Verbindung wird in größeren Mengen als Katalysator für die Schwefelsäureherstellung verwendet. Sie wirkt dort als Sauerstoffüberträger und wird während der Reaktion zu einem weiteren Vanadiumoxid, dem Vanadium(IV)-oxid VO2 reduziert. Weitere bekannte Vanadiumoxide sind Vanadium(III)-oxid V2O3 und Vanadium(II)-oxid VO.
In alkalischer Lösung bildet Vanadium(V)-oxid Vanadate, Salze mit dem Anion VO43−. Im Gegensatz zu den analogen Phosphaten ist jedoch das Vanadat-Ion die stabilste Form; Hydrogen- und Dihydrogenvanadate sowie die freie Vanadiumsäure sind instabil und nur in verdünnten wässrigen Lösungen bekannt. Werden basische Vanadatlösungen angesäuert, bilden sich anstatt der Hydrogenvanadate die Polyvanadate, in denen sich bis zu zehn Vanadateinheiten zusammenlagern. Vanadate finden sich in verschiedenen Mineralen, Beispiele sind Vanadinit, Descloizit und Carnotit.
Halogenverbindungen
Mit den Halogenen Fluor, Chlor, Brom und Iod bildet Vanadium eine Vielzahl von Verbindungen. In der Oxidationsstufe +5 ist nur eine Verbindung, das Vanadium(V)-fluorid bekannt. In den Oxidationsstufen +4, +3 und +2 existieren Verbindungen mit allen Halogenen, lediglich mit Iod sind nur Verbindungen in den Stufen +2 und +3 bekannt. Von diesen Halogeniden sind jedoch nur die Chloride Vanadium(IV)-chlorid und Vanadium(III)-chlorid technisch relevant. Sie dienen unter anderem als Katalysator für die Herstellung von Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk.
Vanadiumoxidchloride
Vanadium bildet auch Mischsalze mit Sauerstoff und Chlor, die sogenannten Vanadiumoxidchloride. Vanadium(III)-oxidchlorid, VOCl, ist ein gelbbraunes, wasserlösliches Pulver. Das in der Photographie und als Textilbeize eingesetzte Vanadium(IV)-oxidchlorid, VOCl2 besteht aus grünen, hygroskopischen Kristalltafeln, die sich in Wasser mit blauer Farbe lösen. Vanadium(V)-oxidchlorid, VOCl3 schließlich ist eine gelbe Flüssigkeit, die durch Wasser sehr leicht hydrolysiert wird. VOCl3 dient als Katalysatorkomponente bei der Niederdruckethenpolymerisation.
Weitere Vanadiumverbindungen
In organischen Vanadiumverbindungen erreicht Vanadium seine niedrigsten Oxidationsstufen 0, −I und −III. Hier sind vor allem die Metallocene, die sogenannten Vanadocene, wichtig. Diese werden als Katalysator für die Polymerisation von Alkinen verwendet.
Vanadiumcarbid VC wird in Pulverform unter anderem zum Plasmaspritzen bzw. Plasma-Pulver-Auftragschweißen eingesetzt. Weiterhin wird Vanadiumcarbid Hartmetallen zugesetzt, um das Kornwachstum zu verringern. Es entstehen dabei die sogenannten Cermets, die besonders hart und verschleißfest sind.
| Allgemein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name, Symbol,Ordnungszahl | Vanadium, V, 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie | Übergangsmetalle | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppe, Periode, Block | 5, 4, d | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aussehen | stahlgrau metallisch, bläulich schimmernd | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS-Nummer | 7440-62-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Massenanteil an derErdhülle | 0,041 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atommasse | 50,9415 u | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomradius (berechnet) | 135 (171) pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kovalenter Radius | 153 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronenkonfiguration | [Ar] 3d3 4s2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Ionisierungsenergie | 650,9 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Ionisierungsenergie | 1414 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Ionisierungsenergie | 2830 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Ionisierungsenergie | 4507 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Ionisierungsenergie | 6298,7 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Physikalisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aggregatzustand | fest | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kristallstruktur | kubisch raumzentriert | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dichte | 6,11 g/cm3 (20 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mohshärte | 7,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magnetismus | paramagnetisch ( = 3,8 · 10−4) = 3,8 · 10−4) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schmelzpunkt | 2183 K (1910 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siedepunkt | 3680 K (3407 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Molares Volumen | 8,32 · 10−6 m3/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verdampfungswärme | 453 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schmelzwärme | 21,5[5] kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schallgeschwindigkeit | 4560 m/s bei 293,15 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifische Wärmekapazität | 489 J/(kg · K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrische Leitfähigkeit | 5 · 106 A/(V · m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wärmeleitfähigkeit | 31 W/(m · K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chemisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxidationszustände | +5, +4 ,+3 ,+2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativität | 1,63 (Pauling-Skala) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isotope | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicherheitshinweise | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| keine GHS-Piktogramme |
H- und P-SätzeH: keine H-SätzeEUH: keine EUH-SätzeP: keine P-Sätze GefahrstoffkennzeichnungPulver
 |
 |
| Leicht- entzündlich |
Reizend |
| (F) | (Xi) |
R- und S-SätzeR: 17-36/37/38 (Pulver)S: 7-26-33-37-43-60 (Pulver)
Informationen zu Strategischen Metallen