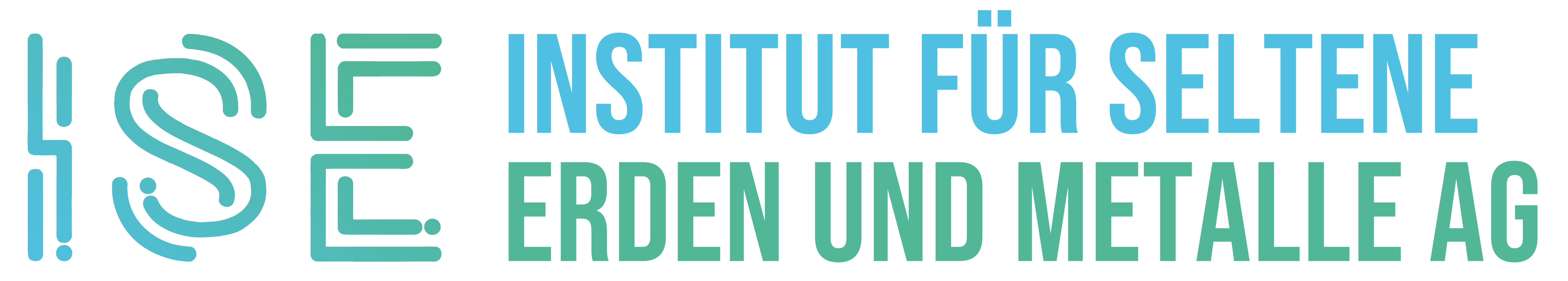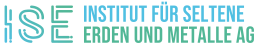Bi • Ordnungszahl 83

Bismut
Wismut ist hart, spröde, grobkristallin und glänzend mit einem rötlichen Schimmer. Es kommt in der Erdkruste in etwa so häufig vor wie Silber. Es zeichnet sich durch Diamagnetismus und seine Dichteanomalie aus: beim Erstarren dehnt sich Wismut um etwa 3,3 Prozent aus. Es hat nach Quecksilber die geringste thermische Leitfähigkeit unter den Metallen und seine elektrische Leitfähigkeit ist sehr schlecht. Unter den Schwermetallen hat es die geringste Toxizität. Allerdings besteht bei Wismut-Pulver unter bestimmten Bedingungen ein Explosionsrisiko.
Wismut wird hauptsächlich in der Pharmazie, Kosmetik, in Legierungen und der Chemieindustrie verwendet und kommt in einer Reihe von Nischenanwendungen zum Einsatz.
Wichtige Produktionsländer sind China, Laos, Vietnam und Japan.
Die größte aktive Wismutmine ist die Shizhuyuan Polymetallic Mine in der chinesischen Provinz Hunan betrieben von Hunan Nonferrous Metals.
Wismut ist ein kritischer Rohstoff für die EU, Japan und Südkorea, die USA stufen das Element als strategisch ein.
Die größten Anwendungsgebiete von Wismut finden sich in der Metallindustrie, Pharmazie (vor allem als Pepto-Bismol), Kosmetik und chemischen Industrie. Wegen seiner antiseptischen Eigenschaften kommt es etwa in Brandsalben vor. In Lidschatten, Lippenstiften und Nagellack sorgt es für Perlglanz.
Metallisches Wismut wird hauptsächlich in Legierungen verwendet, denen es seine besonderen Eigenschaften wie niedrigen Schmelzpunkt und Ausdehnung beim Erstarren verleiht. Wismut ist daher ein nützlicher Bestandteil von Typmetalllegierungen die saubere Gussteile ergeben. In niedrigschmelzenden Legierungen ist es ebenso ein wichtiger Bestandteil. Diese sogenannten Schmelzlegierungen werden in Brandmeldern und Sprinkleranlagen verwendet.
Eine Wismut-Mangan-Legierung hat sich als Dauermagnet bewährt.
In Lötmitteln, Munition und Angelgewichten sowie in der Strahlenabschirmung findet Wismut wegen seiner Ungiftigkeit zunehmend auch als Bleiersatz Verwendung.
Ein weiterer aufstrebender Markt könnte sich aus der Entwicklung neuer Halbleiterklassen, thermoelektrischen Materialien und topologischen Isolatoren ergeben. Wismut könnte darüberhinaus für die Weiterentwicklung von Quantencomputern relevant sein.
Jährlich werden global um die 18.000 Tonnen produziert, das meiste davon in China, das einen Marktanteil von etwa 80 Prozent hält. Weitere Abbau- und Produktionsländer sind Laos, Südkorea, Vietnam und Japan.
Gediegenes Wismut ist in der Natur rar. Die häufigsten wismuthaltigen Erze sind Wismutin (Wismutglanz), Bismit (Wismutocker) und Wismutit.
Wismutvorkommen sind oft auch mit Blei-, Zink-, Zinn- und Silbererzen assoziiert. Es stammt etwa aus Wolframerzen in Südkorea, Bleierzen in Mexiko, Kupfererzen in Bolivien und sowohl Blei- als auch Kupfererzen in Japan.
Mit Beginn des 21. Jahrhunderts hat China sowohl im Abbau als auch in der Raffination von Wismut eine weltweit führende Rolle eingenommen.
Kommerzielles Wismut fällt größtenteils als Nebenprodukt beim Schmelzen und Raffinieren von Blei-, Zinn-, Kupfer-, Silber- und Golderzen an.
Die größte aktive Mine aus der Wismut gewonnen wird, ist die Shizhuyuan Polymetallic Mine in der chinesischen Provinz Hunan, die von der Hunan Nonferrous Metals betrieben wird. Wismut wird hauptsächlich als Nebenprodukt bei der Wolframverarbeitung gewonnen.
Weitere bedeutende Hersteller sind Zhuzhou Keneng New Material, Hunan Jinwang Bismuth Industrial, Yunnan Tin Group (YTC) in China, Met-Mex Peñoles in Mexiko, Masan High-Tech Materials in Vietnam, 5N Plus in Kanada, Belmont Metals in den USA, Comibol in Bolivia und Korea Zinc in Südkorea.
Wismut war schon sehr früh bekannt, da es sowohl gediegen als auch in Verbindungen vorkommt. Es wurde aber lange Zeit nicht eindeutig als eigenständiges Metall erkannt und mit Blei, Antimon und Zinn verwechselt.
Man vermutet, dass es lange vor seiner Entdeckung in Bergwerken als Pigment für silbern glänzende Schriften und Miniaturmalereien verwendet wurde. Dafür wurde das Wismut aus Wismutocker oder Wismutblüten geschmolzen. Im 14. Jahrhundert wurde es im Sächsischen Erzgebirge in elementarer Form entdeckt.
Mitte des 15. Jahrhunderts gewann Wismut Bedeutung als Legierungsbestandteil von Drucklettern. Durch den Zusatz von Wismut lässt sich zum einen der Schmelzpunkt absenken, zum anderen werden die Drucklettern härter und nutzen sich langsamer ab.
Als eigenes Element wurde Wismut nach der Mitte des 18. Jahrhunderts durch die Chemiker Claude François Geoffroy und Johann Heinrich Pott anerkannt.
In Schmelzlegierungen kann Wismut durch das sehr viel teurere Indium oder Gallium ersetzt werden. Auch günstigere Zinn-Blei-Legierungen kommen in Frage, allerdings ist hier die Toxizität zu beachten.
In der Strahlenabschirmung kann es durch Wolfram, Blei und abgereichertes Uran ersetzt werden.
Statt Pepto-Bismol können in der Pharmazie Aluminium-/Magnesiumhydroxid (Antazida) oder Protonenpumpenhemmer (PPI) verwendet werden.
In Kosmetikprodukten kann der Perlglanzeffekt durch Pigmente auf Glimmerbasis statt Wismutoxychlorid erreicht werden.
In Angelgewichten kann Wismut mit Stahl, Zinn oder durch das teurere Wolfram ersetzt werden.
Informationen zu Strategischen Metallen