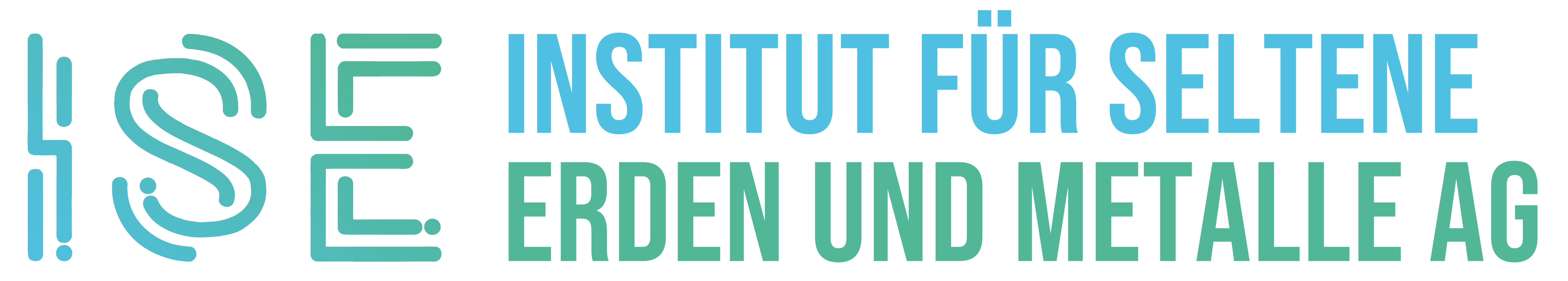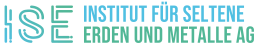Mo • Ordnungszahl 42
Molybdän
Molybdän ist ein silbrig-weißes, glänzendes Übergangsmetall, das Wolfram ähnelt. Es hat mit 2 623 Grad Celsius einen der höchsten Schmelzpunkte unter den Metallen, aber gleichzeitig eine geringe Wärmeausdehnung und eine hohe Wärmeleitfähigkeit. Es ist sehr hart und zäh, aber bei niedrigeren Temperaturen gut formbar. Aufgrund dieser Eigenschaften wird Molybdän in zahlreichen Industrien eingesetzt.
Molybdän ist ein wichtiges Legierungsmetall, das Stählen und Superlegierungen Hitzebeständigkeit und Festigkeit verleiht. Es findet Anwendung in der Elektronik in der Erdölverarbeitung und in Schmierstoffen.
Das Element ist auch biologisch von Bedeutung: als essentielles Spurenelement für Pflanzen, Tiere und Menschen.
In der Natur kommt Molybdän nicht gediegen vor. Die wichtigsten Abbauländer sind China, gefolgt von den USA. Die Climax-Mine im US-Bundesstaat Colorado, ist die größte Molybdän-Mine der Welt und wird von Freeport-McMoRan betrieben. Das US-Unternehmen ist gleichzeitig der weltweit größte Molybdän-Produzent. Molybdän fällt oft auch als Nebenprodukt beim Kupferabbau an.
In der EU steht Molybdän auf der Liste der kritischen Rohstoffe.
In der Antike und im Mittelalter dienten molybdänhaltige Mineralien wie Molybdänglanz, zur Herstellung von Schwertern oder von schwarzen Pigmenten. Molybdänglanz ähnelt Blei, woher sich der Name ableitet: „molybdos" ist die griechische Bezeichnung für Blei.
Der schwedische Chemiker Carl Wilhelm Scheele entdeckte 1778, dass es sich bei Molybdänglanz weder um Graphit noch Blei handelte. Vier Jahres später gelang es seinem Kollegen Peter Jacob Hjelm Molybdänmetall herzustellen
Ab der Mitte des 19. Jahrhunderts wurde Molybdän in kleinen Mengen für Spezialstähle und Pigmente verwendet. Die Nachfrage von Molybdän stieg im 1. Weltkrieg an. Vor allem Deutschland setzte Molybdän als Legierungszusatz für panzerbrechende Geschosse und harte Stähle ein. In diese Zeit fällt auch der Beginn der industriellen Förderung von Molybdän in der Climax-Mine in den USA.
In der Nachkriegszeit erweiterten sich die Anwendungsgebiete auf die Raumfahrt, Erdölindustrie und Elektronik.
Die wichtigste Anwendung von Molybdän ist in Legierungen für Hochleistungsstahl, in Turbinen und Raketen etwa. Als Legierungsmetall erhöht Molybdän die Festigkeit, Korrosions- und Hitzebeständigkeit, was besonders in der Rüstungsindustrie, in der Luft- und Raumfahrt wichtig ist.
In der Petrochemie wird Molybdänsulfid als Katalysator zur Schwefelentfernung eingesetzt.
Molybdänsulfid wird auch als Schmiermittel eingesetzt.
In der Elektronikindustrie dient es in Dünnschichttransistoren als leitende Metallschicht. Molybdän ist kein Halbleiter an sich, aber es dient als Trägermaterial und Komponente in Halbleiterbauelementen.
Das wichtigste Molybdän-haltigen Mineral ist Molybdänit. Der Großteil der kommerziellen Produktion stammt aus Molybdänit.
Mengenmäßig ist China Molybdän-Produzent Nummer eins, gefolgt von den USA, wo sich mit Climax und Henderson, die zwei größten Molybdän-Minen befinden. Der Betreiber Freeport-McMoRan gilt als größter einzelner Produzent des Rohstoffs.
Etwa 60 Prozent der Molybdänförderung stammt aus Kupferminen, wo es als Nebenprodukt anfällt. Der chilenische Bergbaukonzern Codelco ist der zweitgrößte Molybdänproduzent. Molybdän fällt als Nebenprodukt in seinen Kupferminen Chuquicamata und El Teniente an.
Daneben sind China Molybdenum, das in DR Kongo die Tenke Fungurume Mine betreibt, und Grupo Mexico weitere wichtige Hersteller.
Die Jahresproduktion liegt etwa knapp unter 300.000 Tonnen. Die Tendenz ist aufgrund des Ausbaus der Kupferförderung steigend.
Molybdän ist in seiner Hauptanwendung in Stählen und Gusseisen kaum durch andere Stoffe zu ersetzen. Aufgrund der guten Verfügbarkeit und Vielseitigkeit von Molybdän hat die Industrie versucht, neue Werkstoffe zu entwickeln, die von seinen Legierungseigenschaften profitieren.
Mögliche Ersatzstoffe sind Bor, Chrom, Niob und Vanadium in legierten Stählen, Wolfram in Werkzeugstählen, Graphit, Tantal und Wolfram für feuerfeste Materialien in Hochtemperatur-Elektroöfen.
Informationen zu Strategischen Metallen