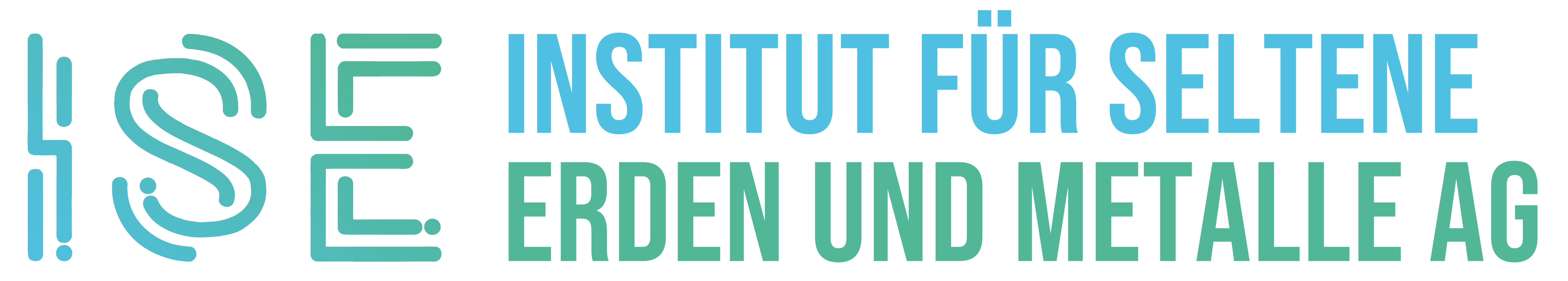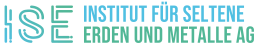Nb • Ordnungszahl 41
Niob
Niob gehört zu den Übergangsmetallen. Es ist grau und gut schmiedbar. Seine physikalischen Eigenschaften ähneln stark denen von Tantal, allerdings kommt Niob in der Erdkruste etwa zehnmal so häufig vor. Niob ist sehr hitzebeständig (Schmelzpunkt: 2.468 Grad Celsius) und bei tiefen Temperaturen supraleitend
Niob wird vor allem in Superlegierungen für die Luft- und Raumfahrt, in Supraleitern für Magneten und Kondensatoren verwendet.
Das wichtigste Abbauland für Niob ist Brasilien. Das Land hat einen Anteil von etwa 90 Prozent der weltweiten Produktion. Das brasilianische Unternehmen Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração (CBMM) ist der weltweit größte Niob-Produzent. CBMM besitzt die Araxá-Mine, eine der größten Niob-Lagerstätten der Welt.
Die weltweit bekannten Niob-Ressourcen reichen völlig aus, um den prognostizierten Bedarf zu decken. Aufgrund der Marktkonzentration in Brasilien gilt Niob sowohl in der EU als auch in den USA offiziell als kritischer Rohstoff.
Niob wurde erstmals 1801 in einer Erzprobe aus Connecticut in den USA vom englischen Chemiker Charles Hatchett entdeckt. Er nannte das Element „Columbium“ zu Ehren seines Fundortes: den USA — Columbia ist ein Synonym für die Vereinigten Staaten. 1802 entdeckte der schwedische Chemiker Anders Gustaf Ekeberg Tantal in einem ähnlichen Mineral (Tantalit) und glaubte zunächst, es handele sich um dasselbe Element wie Hatchetts Columbium. Der britische Chemiker William Hyde Wollaston behauptete, Columbium und Tantal seien identisch.
1844 widerlegte der deutsche Chemiker Heinrich Rose diese Ansicht und zeigte, dass das Mineral Columbit zwei verschiedene Elemente enthielt: das bereits bekannte Tantal und Niob, das Rose nach der mythologischen Göttin Niob, der Tochter des Tantalus, bezeichnete.
Aufgrund der großen chemischen Ähnlichkeit von Niob und Tantal gestaltete sich die Feststellung der individuellen Identität der beiden Elemente sehr schwierig und wurde erst eindeutig durch den Schweizer Chemiker Jean Charles Galissard de Marignac bestätigt.
Hinzu kamen Namensstreitigkeiten, die erst 1950 endeten, nachdem sich die „Internationale Union für reine und angewandte Chemie“ auf die Bezeichnung Niob einigte. In den USA trifft man in einigen Industriesektoren bis heute noch auf die Bezeichnung Columbium und das Kurzzeichen Cb.
Niob wurde zunächst kaum genutzt, da Tantal etwa in Glühfäden bevorzugt wurde. Die Entdeckung der Supraleitfähigkeit von Niob machte es in den 1950er Jahren für Teilchenbeschleuniger und MRT-Magneten interessant.
Seit den 1960er Jahren ist Niob als Legierungszusatz in hochfesten Stählen für Pipelines, Autos, Flugzeugen und in Superlegierungen für die Raumfahrt unverzichtbar.
Etwa drei Viertel des hergestellten Niobs gehen in Form von Ferroniob in die Stahlindustrie, um hochfesten Stahl herzustellen. Ferroniob erhöht im Stahl die Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit, was besonders für Pipelines, Brücken und Autokarrosserien von Bedeutung ist.
Niob wird außerdem in Supraleitern eingesetzt, da es bei extrem tiefen Temperaturen (<9,2 K) widerstandslos Strom leitet.
Der Teilchenbeschleuniger am CERN nutzt Magnete aus Niob-Titan- oder Niob-Zinn-Legierungen. In medizinischen MRT-Geräte werden Magnetspulen aus Niob-Titan verwendet.
Etwa ein Fünftel der weltweit hergestellten Niobmengen wird für Superlegierungen für die Luft- & Raumfahrt benutzt. Niobhaltige Legierungen werden für Turbinenschaufeln in Jet- und Raketentriebwerken sowie in Raumfahrzeugkomponenten wie Düsen und Wärmeschilde eingesetzt.
Niob ist auch ein interessanter Werkstoff für Kondensatoren. Niob-Elektrolytkondensatoren sind eine günstigere und umweltfreundlichere Alternative zu Tantal-Kondensatoren. In der Elektronik kommt Niob in Smartphones, Laptops und Elektroautos zum Einsatz.
Nischenanwendungen für Niob sind die Nukleartechnik, Schmuck (hypoallergen) und Quantencomputer.
Columbit und Tantalit stellen die wichtigsten kommerziellen abbaubaren Quellen für Niob dar.
Das führende Abbauland ist Brasilien, das auch die größten und wirtschaftlichsten Vorkommen besitzt. Mit einem Weltmarktanteil von 80 Prozent ist Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração (CBMM) mit deutlichem Abstand Weltmarktführer. Der Großteil der brasilianischen Exporte geht dabei nach China.
Kanada ist der zweitwichtigste Niobproduzent gefolgt von Ruanda und der DR Kongo.
Jährlich werden weltweit etwa 100000 Tonnen Niob abgebaut. Die bekannten Reserven decken mehr als ausreichend die prognostizierte Nachfrage ab.
Die folgenden Materialien können Niob ersetzen, allerdings kann es dabei zu Leistungseinbußen oder höheren Kosten kommen:
Keramikmatrix-Verbundwerkstoffe, Molybdän, Tantal und Wolfram in Hochtemperaturanwendungen (Superlegierungen).
Molybdän, Tantal und Titan als Legierungselemente in rostfreien und hochfesten Stählen.
Molybdän und Vanadium als Legierungselemente in hochfesten niedriglegierten Stählen.
Informationen zu Strategischen Metallen