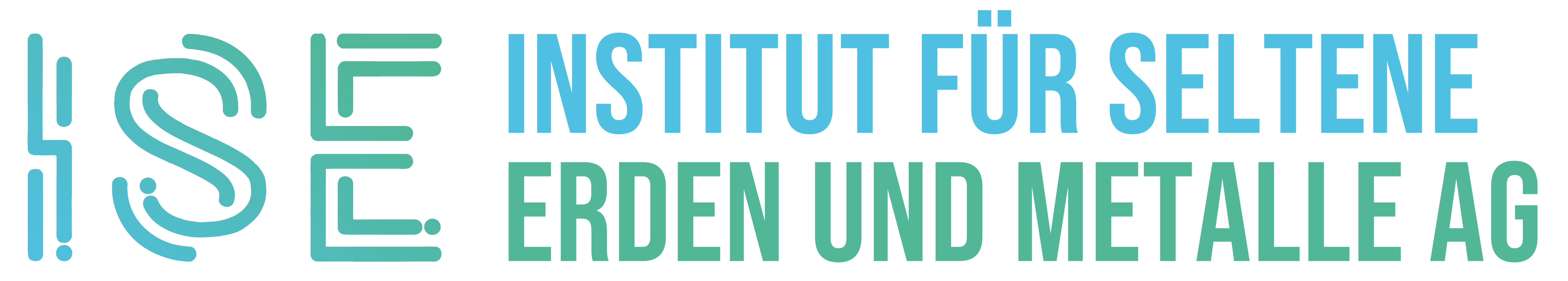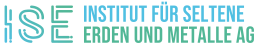Sn • Ordnungszahl 50

Zinn
Zinn ist ein silberweiß glänzendes und sehr weiches Schwermetall. Es lässt sich mit dem Fingernagel ritzen, ist elektrisch leitfähig und läßt sich gut legieren. Zinn hat einen für Metalle sehr niedrigen Schmelzpunkt, weswegen es sich gut als Lötmittel eignet. Es ist auch korrosionsbeständig und ungiftig, was die Anwendung in Lebensmittelverpackungen ermöglicht.
Die Hauptanwendung ist in der Elektronikindustrie als Lötmittel. Ein weiterer wichtiger Sektor ist die Verpackungsindustrie, wo Zinn als Weißblech in Getränke- und Konservendosen verwendet wird.
China ist das führende Abbauland für Zinn gefolgt von Indonesien, Burma und Peru.
Die zwei größten Minen sind die Man Maw-Mine in Burma und San Rafael in Peru.
Yunnan Tin Group in Yunnan, China, ist der weltweit führende Zinnproduzent mit einem Fünftel der Weltproduktion.
Zinn prägte als Legierung mit Kupfer eine ganze Epoche: die Bronzezeit (ca. 3000–1200 v. Chr.). Bronze war härter als reines Kupfer und revolutionierte Werkzeuge, Waffen und Kunst. In Indien war die Bronzeherstellung schon um 3000 v. Chr. bekannt. Seit dem 2. Jahrtausend v. Chr. wurde Zinn in Mittelasien an der Route der späteren Seidenstraße nachweislich in größerem Maße in Bergwerken abgebaut.
Wahrscheinlich schon vor 1800 v. Chr. war Zinn auch in China bekannt. Im Euphrattal waren Bronzegeräte und deren Herstellung ab 2000 v. Chr. ein wichtiger Kulturfaktor.
Zinn wurde über große Entfernungen gehandelt, wovon die „Zinnstraße“ eine transeuropäische Handelsroute zeugt. Wichtige Abbaustätten waren Cornwall in England, die französische Bretagne und Anatolien in der Türkei.
Im Alten Rom wurde Zinn, das aus Cornwall kam, für Geschirr und Wasserleitungen verwendet. Im Mittelalter entstand die Zunft der Zinngießer. Zinn wurde für Orgelpfeifen, Kerzenhalter und Trinkgefäße verwendet.
Im 19. Jahrhundert revolutionierte die Erfindung von Weißblech und dessen Verwendung für Nahrungsmittelkonservierung die Logistik von Armeen. Als Lötmittel wurde Zinn in der Elektronik wichtig. So wurde Zinn zu einem kriegswichtigen Rohstoff und Länder legten staatliche Vorräte an.
Der größte Anwendungsbereich für Zinn ist in der Elektronik, wohin die Hälfte der Zinnproduktion geht. Zinn dient als Lötverbindung für Elektronikbauteile. Zinnbeschichtungen auf Leiterplatten schützen vor Korrosion. In der Halbleiterindustrie werden Zinnverbindungen wie Indium-Zinn-Oxid (ITO) für Touchscreens verwendet.
Ein weiterer wichtiger Sektor ist die Verpackungsindustrie, in der Zinn für Weißblech verwendet wird. Hier werden Getränke- und Konservendosen mit einer dünnen Zinnschicht überzogen, um Rost zu vermeiden.
Zinn wird darüber hinaus in verschiedenen Legierungen verwendet.
Das wichtigste Zinnerz, aus dem der Großteil des weltweiten Zinns gewonnen wird, ist Kassiterit. Der Zinngehalt erreicht fast 80 Prozent. Kommt vor allem in granitischen Pegmatiten und alluvialen Seifenlagerstätten (Flusssedimenten) vor.
China ist das führende Abbauland für Zinn gefolgt von Indonesien, Burma und Peru. Bedeutende Mengen stammen auch aus dem konfliktbehafteten Kongo. Kassiterit zählt in den USA sowie in der EU zu den vier Konfliktmineralien, von deren Abbau aus illegalen Minen im Kongo korrupte Armeeeinheiten, Milizen, Rebellengruppen und ausländische Akteure profitieren. Der Handel trägt zu Gewalt, Menschenrechtsverletzungen und Umweltzerstörung bei.
Die größte Zinnmine der Welt, Man Maw in Burma, liegt ebenfalls in einer Konfliktregion. Sie ist eine wichtige Zinnquelle für chinesische Zinnhütten.
In Peru befindet sich mit der San Rafael-Mine, die von Minsur betrieben wird, die zweitgrößte Mine der Welt.
Yunnan Tin Group in Yunnan, China, ist der weltweit führende Zinnproduzent mit einem Fünftel der Weltproduktion. Das Unternehmen unterhält eigene Minen und mehrere Hütten. Timah, ein indonesischer Staatskonzern, ist der zweitgrößter Produzent weltweit, gefolgt von Minsur in Peru.
Die weltweiten Ressourcen, vor allem in Westafrika, Südostasien, Australien, Bolivien, Brasilien, Indonesien und Russland, sind beträchtlich und könnten, wenn sie erschlossen würden, die aktuellen jährlichen Produktionsraten auch in Zukunft aufrechterhalten.
Die globale Jahresproduktion wird auf 300 Millionen Tonnen geschätzt.
Etwa 30 Prozent des weltweiten Zinns stammt aus Recycling.
Aluminium, Glas, Papier, Kunststoff oder zinnfreier Stahl ersetzen Zinn in Dosen und Behältern. Weitere Materialien, die Zinn ersetzen, sind Epoxidharze für Lötmittel, Aluminiumlegierungen, alternative Kupferlegierungen und Kunststoffe für Bronze, Kunststoffe für zinnhaltige Lagermetalle sowie Blei- und Natriumverbindungen für einige Zinnchemikalien.
Als qualitative Nachweisreaktion für Zinnsalze wird die Leuchtprobe durchgeführt: Die Lösung wird mit ca. 20%iger Salzsäure und Zinkpulver versetzt, wobei naszierender Wasserstoff frei wird. Der naszierende, atomare Wasserstoff reduziert einen Teil des Zinns bis zum Stannan SnH4. In diese Lösung wird ein Reagenzglas eingetaucht, das mit kaltem Wasser und Kaliumpermanganatlösung gefüllt ist; das Kaliumpermanganat dient hier nur als Kontrastmittel. Dieses Reagenzglas wird im Dunkeln in die nichtleuchtende Bunsenbrennerflamme gehalten. Bei Anwesenheit von Zinn entsteht sofort eine typisch blaue Fluoreszenz, hervorgerufen durch SnH4.
Zur quantitativen Bestimmung von Zinn eignet sich die Polarographie. In 1 M Schwefelsäure ergibt Zinn(II) eine Stufe bei −0,46 V (gegen Kalomelelektrode, Reduktion zum Element). Stannat(II) lässt sich in 1 M Natronlauge zum Stannat(IV) oxidieren (−0,73 V) oder zum Element reduzieren (−1,22 V). Im Ultraspurenbereich bieten sich die Graphitrohr- und Hydridtechnik der Atomspektroskopie an. Bei der Graphitrohr-AAS werden Nachweisgrenzen von 0,2 µg/l erreicht. In der Hydridtechnik werden die Zinnverbindungen der Probelösung mittels Natriumborhydrid als gasförmiges Stannan in die Quarzküvette überführt. Dort zerfällt das Stannan bei ca. 1000 °C in die Elemente, wobei der atomare Zinndampf spezifisch die Sn-Linien einer Zinn-Hohlkathodenlampe absorbiert. Hier sind 0,5 µg/l als Nachweisgrenze angegeben worden.
Metallisches Zinn ist auch in größeren Mengen an sich ungiftig. Die Giftwirkung einfacher Zinnverbindungen und Salze ist gering. Einige organische Zinnverbindungen dagegen sind hochtoxisch. Die Trialkyl-Zinnverbindungen (insbesondere TBT, engl. „Tributyltin“, Tributylzinn) und Triphenylzinn wurden mehrere Jahrzehnte in Anstrichfarben für Schiffe verwendet, um die sich an den Schiffsrümpfen festsetzenden Mikroorganismen und Muscheln abzutöten. Dadurch kam es in der Umgebung von großen Hafenstädten zu hohen Konzentrationen an TBT im Meerwasser, die die Population diverser Meereslebewesen bis heute beeinträchtigen. Die toxische Wirkung beruht auf der Denaturierung einiger Proteine durch die Wechselwirkung mit dem Schwefel aus Aminosäuren wie beispielsweise Cystein.
Zinnverbindungen kommen in den Oxidationsstufen +II und +IV vor. Zinn(IV)-Verbindungen sind stabiler, da Zinn ein Element der IV. Hauptgruppe ist und zudem der Effekt des inerten Elektronenpaares noch nicht so stark ausgeprägt ist wie bei den schwereren Elementen dieser Gruppe, z. B. dem Blei. Zinn(II)-Verbindungen lassen sich deshalb leicht in Zinn(IV)-Verbindungen umsetzen. Viele Zinnverbindungen sind anorganischer Natur, es ist aber auch eine Reihe von zinnorganischen Verbindungen (Zinnorganylen) bekannt.
Oxide und Hydroxide
- Zinn(II)-oxid SnO
- Zinn(II,IV)-oxid Sn2O3
- Zinn(IV)-oxid SnO2
- Zinn(II)-hydroxid Sn(OH)2
- Zinn(IV)-hydroxid Sn(OH)4, CAS-Nummer: 12054-72-7
Halogenide
- Zinn(II)-fluorid SnF2
- Zinn(II)-chlorid SnCl2
- Zinn(IV)-chlorid SnCl4
- Zinn(IV)-bromid SnBr4
- Zinn(II)-iodid SnI2
- Zinn(IV)-iodid SnI4
Salze
- Zinn(II)-sulfat SnSO4
- Zinn(IV)-sulfat Sn(SO4)2
- Zinn(II)-nitrat Sn(NO3)2
- Zinn(IV)-nitrat Sn(NO3)4
- Zinn(II)-oxalat Sn(COO)2
- Zinn(II)-pyrophosphat Sn2P2O7
- Zinkhydroxystannat ZnSnO3 · 3 H2O, CAS-Nummer: 12027-96-2
Chalkogenide
- Zinn(II)-sulfid SnS
- Zinn(IV)-sulfid SnS2
- Zinn(II)-selenid SnSe
Organische Zinnverbindungen
- Dibutylzinndilaurat (DBTDL) C32H64O4Sn
- Dibutylzinnoxid (DBTO) (H9C4)2SnO
- Dibutylzinndiacetat C12H24O4Sn, CAS-Nummer: 1067-33-0
- Diphenylzinndichlorid C12H10Cl2Sn
- Tributylzinnhydrid C12H28Sn
- Tributylzinnchlorid (TBTCL) (C4H9)3SnCl
- Tributylzinnfluorid (TBTF) C12H27FSn, CAS-Nummer: 1983-10-4
- Tributylzinnsulfid (TBTS) C24H54SSn2, CAS-Nummer: 4808-30-4
- Tributylzinnoxid (TBTO) C24H54OSn2
- Triphenylzinnhydrid C18H16Sn
- Triphenylzinnhydroxid C18H16OSn
- Triphenylzinnchlorid C18H15ClSn
- Tetramethylzinn C4H12Sn
- Tetraethylzinn C8H20Sn
- Tetrabutylzinn C16H36Sn
- Tetraphenylzinn (H5C6)4Sn
Weitere Verbindungen
- Stannan SnH4
- Natriumstannat Na2SnO3
- Kaliumstannat K2SnO3, CAS-Nummer: 12142-33-5
- Zinndifluorborat Sn(BF4)2, CAS-Nummer: 13814-97-6
- Zinn(II)-2-ethylhexanoat Sn(OOCCH(C2H5)C4H9)2
- Zinn(II)-oleat Sn(C17H34COO), CAS-Nummer: 1912-84-1
- Zinntellurid SnTe
- Indiumzinnoxid, ein Mischoxid üblicherweise aus 90 % Indium(III)-oxid (In2O3) und 10 % Zinn(IV)-oxid (SnO2)