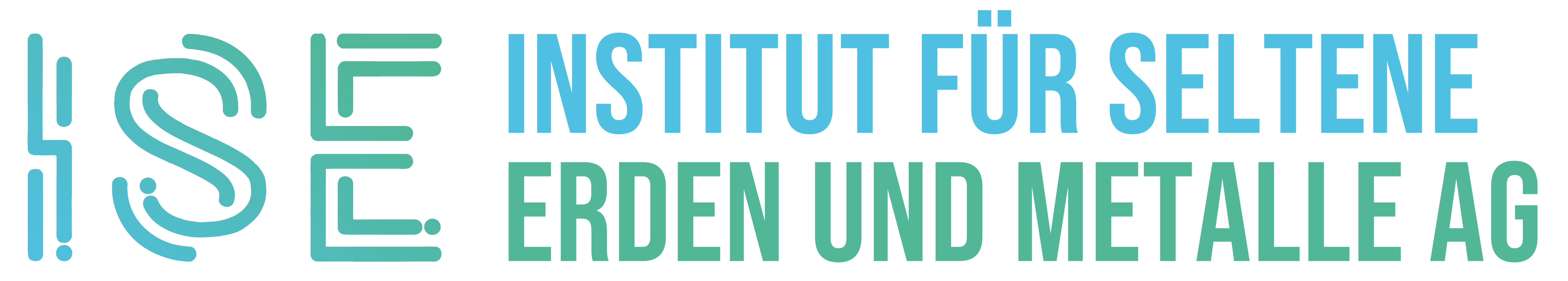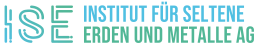AI • Ordnungszahl 13

Aluminium
Aluminium ist ein silbrig-weißes Leichtmetall. Es sticht durch sein geringes Gewicht, Korrosionsbeständigkeit und seine gute Wärmeleitfähigkeit hervor. Es ist gut formbar und nicht magnetisch. Aluminium hat in etwa ein Drittel der Dichte von Eisen. Der Schmelzpunkt ist mit 660 Grad Celsius relativ niedrig.
Es ist das dritthäufigste Element und das häufigste Metall in der Erdkruste.
Nach Eisen ist Aluminium das zweitwichtigste Metall für die Industrie. Die wichtigste Verwendung ist im Bausektor sowie im Leichtbau (Autoindustrie, Luft- und Raumfahrt).
Die Weipa-Mine in Australien ist die weltgrößte Abbaustätte für Bauxit, dem Mineral aus dem Aluminium gewonnen wird. Seinen Namen verdankt Bauxit seinem ersten Fundort Les Baux-de-Provence in Südfrankreich, wo es 1822 vom Geologen Pierre Berthier entdeckt wurde.
Der größte Bauxitförderer ist Rio Tinto, gefolgt von Winning International, das die Simandou-Mine in Guinea betreibt. Guinea verfügt über die größten Aluminiumreserven weltweit.
Marktführer in der Aluminiumproduktion ist China, das einen Marktanteil von fast 60 Prozent hat. Chinalco und Hongqiao Group sind dabei die führenden Unternehmen.
Aluminium kann ohne Qualitätsverlust recycelt werden und der Prozess verbraucht dabei nur einen Bruchteil der Energie, die in der Primärherstellung notwendig ist.

Alaun (Aluminiumsalz) war bereits im Altertum bekannt. In der Antike wurde es in Ägypten und Rom in der Medizin und zum Färben eingesetzt.
1754 entdeckt der deutsche Chemiker Andreas Sigismund Marggraf Tonerde (Al₂O₃) als eigenständige Substanz. Der französische Chemiker Antoine Laurent de Lavoisier vermutete als erster, dass es sich bei der von Marggraf aus einer Alaunlösung gewonnenen Alaunerde um das Oxid eines bislang unbekannten Elements handle.
Der Brite Sir Humphry Davy versucht 1808 erstmals, Aluminium elektrolytisch herzustellen – erfolglos. Er führte jedenfalls die Namensvarianten alumium, aluminum und aluminium ein, von welchen die letzten beiden im Englischen nebeneinander fortbestehen.
Die Darstellung von Aluminium glückte schließlich 1825 dem Dänen Hans Christian Ørsted. Mehrere Chemiker optimierten daraufhin den Herstellungsprozess, unter anderem Friedrich Wöhler, dem es 1845 endlich gelang, einige winzige Aluminiumkügelchen herzustellen. Damit konnte er dann auch die Dichte des Metalls bestimmen.
1846 setzte Henri Étienne Sainte-Claire Deville die Versuche, die Aluminiumgewinnung zu verbessern und vor allem günstiger zu machen, fort. Er überzeugte Kaiser Napoleon III. Die Entwicklung der industriellen Herstellung von Aluminium finanziell zu unterstützen. Nach erfolgreichen Versuchen begann Deville in der Chemischen Fabrik der Brüder Rousseau mit der industriellen Herstellung von Aluminium. Er entwickelte das Wöhlerverfahren weiter indem er statt des teuren Kaliums das billigere Natrium als Reduktionsmittel benutzte. Dies senkte die Kosten für die Aluminiumgewinnung deutlich. Der Aluminiumspreis, der zuvor höher als Gold war, sank empfindlich. 1854 kostete 1 Kilo Aluminium noch 3000 Francs, 1860 sank der Kilopreis auf 130 Francs.
1886 entwickelten Charles Martin Hall und Paul Héroult unabhängig voneinander das heute nach ihnen benannte Elektrolyseverfahren zur Herstellung von Aluminium: der Hall-Héroult-Prozess.
1889 erfand Carl Josef Bayer das nach ihm benannte Bayer-Verfahren zur Isolierung von reinem Aluminiumoxid aus Bauxiten. Aluminium wird noch heute nach diesem Prinzip großtechnisch hergestellt.
Ende des 19. Jahrhunderts setzte die Verwendung in industriellem Maßstab ein, nachdem Aluminiumhütten neben Wasserkraftwerken (USA: Niagarafälle, Schweiz: Hochrhein), die günstig Strom produzierten, errichtet wurden. Aluminium konnte so billig hergestellt werden, dass es für allgemeine Gebrauchsartikel erschwinglich wurde. Die ersten Verwendungen für das leichte Metall fanden sich beim Militär, das an Gewichtsreduzierungen für die Ausrüstung der Soldaten interessiert war: Es wurden Feldflaschen, Kochgeschirre und Zeltstangen produziert.
Wegen seines geringen Gewichts war Aluminium geradezu prädestiniert für die Luftfahrt. Die Karriere des Leichtmetalls in dieser Branche begann mit dem Zeppelin, das 1900 erstmals in die Lüfte abhob und auch unversehrt wieder landete.
Der bedeutendste Aluminiumverbraucher ist die Bauindustrie, deren Bedarf zwischen einem Viertel und einem Drittel der Gesamtproduktion ausmacht.
Die Verpackungsindustrie, Autobranche sowie die Luft- und Raumfahrt verbrauchen jeweils ein Fünftel der globalen Produktionsmenge.
Weitere Anwendungen für Aluminium sind Elektrotechnik und Maschinenbau. In E-Autos besteht ein um rund 30 Prozent erhöhter Aluminiumbedarf im Vergleich zu Verbrennern.
Der größte Aluverbraucher ist China aufgrund staatlicher Infrastrukturprojekte im In- und Ausland.
Bauxit ist das wichtigste Mineral für die Aluminiumproduktion. Es beinhaltet 50 bis 60 Prozent Aluminiumoxid und 30 Prozent Eisenoxid.
Die Herstellung von Aluminiummetall aus Bauxit erfolgt in zwei Stufen: im Bayer-Verfahren wird zunächst Aluminiumoxid (Alumina) gewonnen. Im zweiten Schritt wird durch den Hall-Héroult-Prozess Alumina zu Aluminium reduziert. Als Rückstand bleibt eisenhaltiger Rotschlamm zurück.
Guinea ist das größte Förderland für Bauxit und verfügt auch über die größten Bauxit-Reserven. Australien ist das zweitwichtigste Abbauland, hat jedoch auch die weltweit zweitgrößte Aluminaproduktion. An dritter Stelle rangiert beim Bauxitabbau China.
Die zur Rio-Tinto-Gruppe gehörende Weipa-Mine in Australien ist die größte Bauxitabbaustätte der Welt. Rio Tinto ist globaler Marktführer bei der Bauxitförderung gefolgt von Winning International Group und der guineischen Regierung.
Bei der energieintensiven Aluminiumherstellung ist China mit einem Marktanteil von fast 60 Prozent global führend. Russland, Kanada und die Vereinigten Arabischen Emirate sind weitere wichtige Aluminiumhersteller.
Die globale Jahresproduktion von Bauxit beläuft sich auf über 400 Millionen Tonnen.
Daraus werden weltweit jährlich um die 140.000 Tonnen Primäraluminium gewonnen.
Aufgrund des niedrigeren Energiebedarfs spielt das Recycling von Aluminium eine große Rolle. Aluminium gehört zu den am meisten wiederverwerteten Metallen. Nordamerika hat mit fast 60 Prozent die höchsten Alu-Recyclingraten der Welt.
Verbundwerkstoffe können Aluminium in Flugzeugrümpfen und Tragflächen ersetzen.
Glas, Papier, Kunststoffe und Stahl können Aluminium in Verpackungen ersetzen. Verbundwerkstoffe, Magnesium, Stahl und Titan können Aluminium in Bodentransportmitteln ersetzen.
Verbundwerkstoffe, Stahl, Vinyl und Holz können Aluminium im Bauwesen ersetzen.
Kupfer kann Aluminium in Elektro- und Wärmeaustauschanwendungen ersetzen.