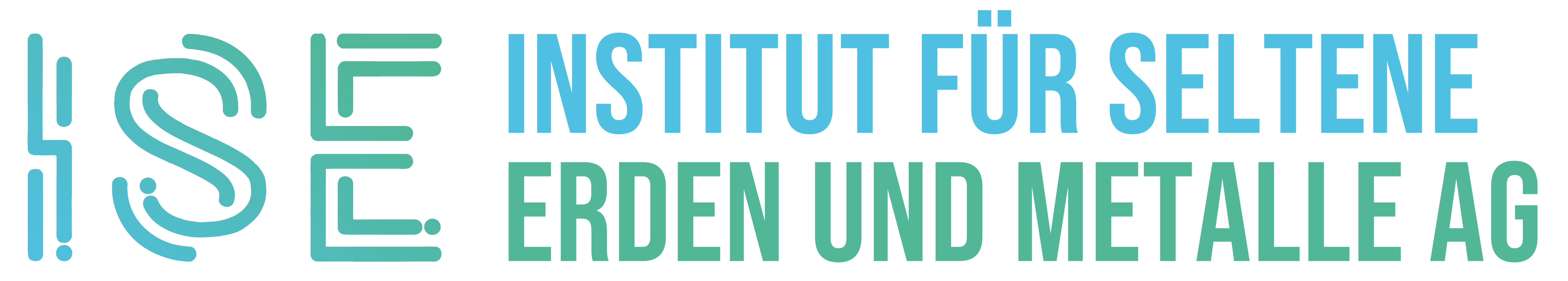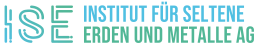Dy • Ordnungszahl 66
Dysprosium
Dysprosium ist ein silbergraues bieg- und dehnbares Metall, das zu den schweren Seltenen Erden gehört.
Es ist sehr reaktionsfreudig. Zusammen mit Holmium besitzt Dysprosium das höchste magnetische Moment (10,6 μB) aller natürlich vorkommenden chemischen Elemente.
Die Entdeckung des Dysprosiums geht auf die Untersuchungen des Gadolinit (damals noch Ytterbit genannt) zurück. Dieses Mineral stammte aus der Grube Ytterby bei Stockholm (Schweden).
1879 entdeckten Per Theodor Cleve und Jacques-Louis Soret unabhängig voneinander bei spektroskopischen Untersuchungen, dass in Erbium noch weitere Elemente enthalten sein müssen. Diese wurden nach dem Vorschlag von Cleve Holmium und Thulium genannt.
Paul Émile Lecoq de Boisbaudran führte 1886 Fraktionierungsexperimente zum Holmium durch und fand heraus, dass es ein weiteres Element geben müsse. Da das bislang unbekannte Element experimentell kaum erreichbar war und es ihm nicht gelang, eine reine Fraktion herzustellen, nannte Lecoq de Boisbaudran es Dysprosium, das „Unzugängliche“.
Georges Urbain gelang 1906 erstmals die Gewinnung von reinem Dysprosiumoxid. 1936 isolierten Wilhelm Klemm und Heinrich Bommer erstmals metallisches Dysprosium. 1950 wurde von Frank Harold Spedding eine effektive Trennmöglichkeit von Dysprosium und Yttrium durch Ionenaustausch entwickelt.
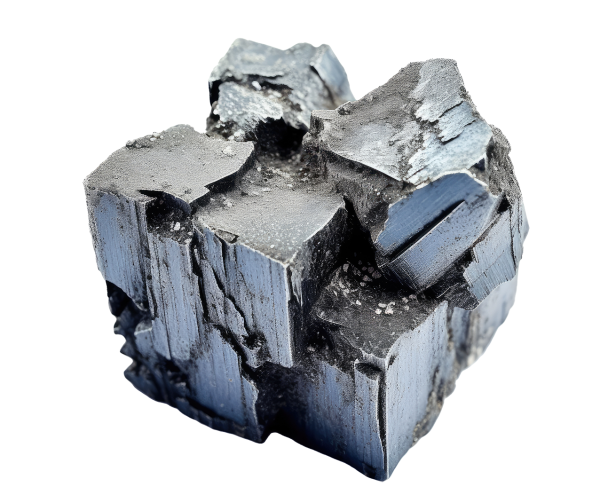
Das Vorkommen von Dysprosium in der kontinentalen Erdkruste beträgt etwa 5,2 ppm. Es liegt damit in seiner Häufigkeit hinter den meisten leichten Seltenen Erden wie Cer, Neodym oder Samarium, aber vor den meisten schweren wie Erbium, Ytterbium oder Holmium.
Minerale mit besonders hohem Dysprosiumanteil sind beispielsweise Xenotim und Gadolinit-(Y). Die für die Gewinnung von anderen Lanthanoiden wichtigen Erze Monazit und Bastnäsit enthalten dagegen nur geringe Mengen Dysprosium.
Die wichtigsten Quelle für Dysprosium sind ionenadsorbierende Tonminerale (Tonlagerstätten) aus Südchina (Provinzen Jiangxi und Guangdong) und Myanmar.
Die Seltenen Erden sind in den Tonlagerstätten nicht Teil einer Kristallstruktur, sondern als Ionen an Tonpartikel adsorbiert. Dadurch lassen sie sich durch ein Ionenaustauschverfahren besonders einfach und kostengünstig gewinnen. Entscheidend ist, dass diese Lagerstätten stark mit den begehrten schweren Seltenen Erden wie Dysprosium und Terbium angereichert sind.
Nach einer aufwändigen Abtrennung der anderen Dysprosiumbegleiter wird das Oxid mit Fluorwasserstoff zum Dysprosiumfluorid umgesetzt. Anschließend wird mit Calcium unter Bildung von Calciumfluorid zum metallischen Dysprosium reduziert. Abtrennung verbleibender Calciumreste und Verunreinigungen erfolgen in einer zusätzlichen Umschmelzung im Vakuum. Nach einer Destillation im Hochvakuum gelangt man zum hochreinen Dysprosium.
Die kommerzielle Trennung erfolgt durch Flüssig-Flüssig-Extraktion oder Ionenaustauschverfahren. Das Metall wird durch metallothermische Reduktion der wasserfreien Halogenide mit Alkali- oder Erdalkalimetallen hergestellt. Das Metall wird durch Vakuumdestillation weiter gereinigt. Dysprosium existiert in drei allotropen (strukturellen) Formen. Die α-Phase ist dicht besetzt hexagonal (HCP [vgl. Kristallstrukturen]) mit a = 3,5915 Å und c = 5,6501 Å bei Raumtemperatur. Bei Abkühlung auf ~90 K (-183 °C bzw. -297 °F) wird die ferromagnetische Ordnung von einer orthorhombischen Verzerrung des HCP-Gitters begleitet. Die β-Phase hat a = 3,595 Å, b = 6,184 Å und c = 5,678 Å bei 86 K (-187 °C, oder -305 °F). Die γ-Phase ist körperzentriert kubisch (BCC) mit a = 4,03 Å bei 1381 °C (2518 °F).
Die Haupteinsatzgebiete von Dysprosium sind Legierungszusätze zu Nd2Fe14B-Permanentmagnetwerkstoffen (bei denen ein Teil des Neodyms durch Dysprosium ersetzt ist), um sowohl den Curie-Punkt als auch insbesondere die Koerzitivfeldstärke zu erhöhen und damit das Hochtemperaturverhalten der Legierung zu verbessern. Das Metall ist auch Bestandteil des magnetostriktiven Terfenol D (Tb0,3Dy0,7Fe2).
Dysprosium wird wegen seines relativ hohen Neutronenabsorptionsquerschnitts in Steuerstäben für Kernreaktoren verwendet; seine Verbindungen wurden zur Herstellung von Lasermaterialien und Phosphoraktivatoren sowie in Halogen-Metalldampflampen verwendet.
Die wirtschaftliche und technische Bedeutung von Dysprosium ist relativ gering. So wird seine Fördermenge auf weniger als 100 Tonnen pro Jahr geschätzt. Es findet Verwendung in verschiedenen Legierungen, in Spezialmagneten und mit Blei legiert als Abschirmmaterial in Kernreaktoren. Jedoch gerade die Verwendung in den Magneten für Windkraftanlagen hat diese Metalle der Seltenen Erden zum raren Rohstoff gemacht, zudem drosselt der weltweit größte Lieferant China seine Lieferung, um die eigene Wertschöpfung zu erhöhen.